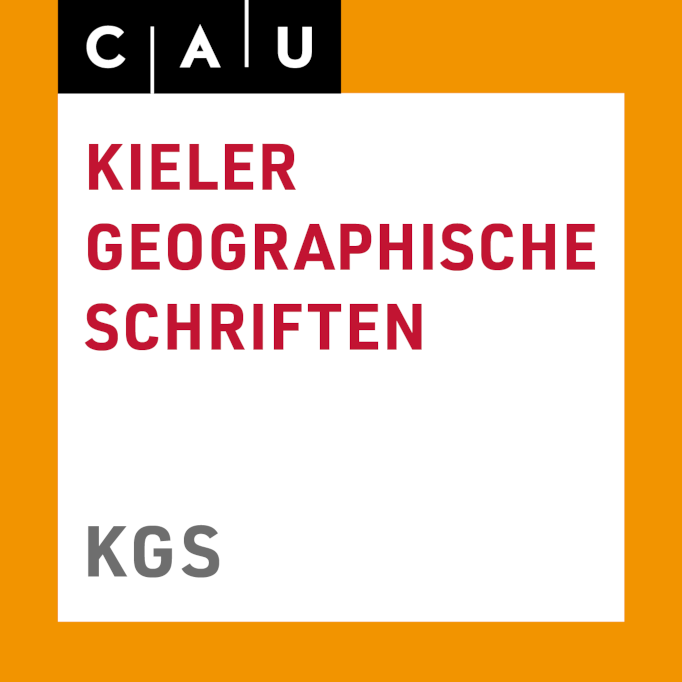Urbane Konflikte und stadtpolitischer Wandel untersucht an Fallbeispielen in Buenos Aires
Die vorliegende Arbeit untersucht im Rahmen von urbanen Konflikten in Buenos Aires die Aktivitäten von Bürgerinitiativen und das sich daraus ergebende Wechselspiel politisch wirksamer Handlungen zwischen Teilen der Zivilgesellschaft und politischen Entscheidungsträgern. Das geschieht vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Debatte, die im Kontext neoliberaler Urbanisierung ein Ende effektiver demokratischer Mitsprache heraufziehen sieht. Begründet wird diese Annahme mit der anscheinenden Marginalisierung und Instrumentalisierung zivilgesellschaftlichen Einflusses auf Stadtentwicklung zu Gunsten ökonomischer und politischer Eliten sowie der beständigen Gefahr der Kooptation durch neoliberale Ideen und ökonomische Interessen. Diese Debatte wird zum Anlass genommen, im spezifischen Kontext der argentinischen Hauptstadt der Fragestellung nachzugehen, wie groß die Spielräume zivilgesellschaftlichen Einflusses sind und welche Strategien und Faktoren eine erfolgreiche Nutzung derselben beeinflussen. Zu diesem Zweck werden zuerst die spezifischen Gründe herausgearbeitet, mit denen sich die besondere Konfliktivität neoliberaler Stadtentwicklung und der begrenzte Einfluss der Zivilgesellschaft im Rahmen neoliberaler Governance begründen lassen. Anschließend wird unter Rückgriff auf Erkentnisse der Bewegungsforschung, des Neuen Institutionalismus und der geographischen Konfliktforschung ein theoretischer Rahmen entwickelt, mit dem sich die Wirkungsmechanismen politischen Wandels und die einzelnen Faktoren, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind, identifizieren und analysieren lassen. Anhand von zwei Fallbeispielen, den Konflikten um den Bau von Hochhäusern im Stadtviertel Caballito und der Touristifizierung des Stadtviertels San Telmo, werden mit Methoden der qualitativen Sozialforschung (leitfadengestützte Interviews, Medienanalyse sowie Beobachtung) die Wirkungsmechanismen und konfliktiven Auhandlungsprozesse um Stadtentwicklung in Buenos Aires rekonstruiert und analysiert. Die Fallbeispiele zeigen, dass die untersuchten Konflikte maßgeblich durch eine verdeckte, aber als Folge neoliberaler Stadtentwicklung offen zu Tage tretende, raumgebundene Identität ausgelöst werden. In ihrem Verlauf sind diese durch eine Vielzahl von Interaktionen und Wechselwirkungen zwischen Bürgerinitiativen und politischen Entscheidungsträgern gekennzeichnet, die sich zuerst in einem Kampf um die öffentliche Deutungshoheit und im weiteren Verlauf in gemeinsamen Aushandlungsprozessen äußern. Die Fähigkeit, durch innovative Strategien das eigene Anliegen auf die politische Agenda zu bringen, mit der so gewonnenen Verhandlungsmacht Zugang zu politischen Entscheidungsträgern zu generieren sowie deren Handlungslogiken im Aushandlungsprozess zu berücksichtigen, entscheidet über Erfolg oder Mißerfolg politischen Protests. Dabei spielen eine Reihe von Faktoren eine wichtige Rolle: Das sind neben der Bedeutung formal-kodifizierter Regelungen als institutionelle Spielregeln, der Rolle potenzieller Unterstützer in den Medien oder den politischen Institutionen und der Anschlussfähigkeit der formulierten Rahmungen (frames) insbesondere die räumliche Verbreitung der Konfliktursache als ein Faktor, der die Dynamik der untersuchten Fallbeispiele maßgeblich beeinflusst. Im Hinblick auf die Theorie zeigt die vorliegende Untersuchung, dass stadtpolitischer Wandel keinen einseitigen Prozess in Form einer kontinuierlichen Neoliberalisierung von Stadtentwicklung darstellt. Die Bereitschaft, sich im Rahmen bestehender politischer Institutionen auf die Logiken politischen Handelns einzulassen erlaubt es zivilgesellschaftlichen Akteuren, entgegen der unterstellten Wirkungslosigkeit zivilgesellschaftlichen Protests substantielle Transformationen zu erzeugen. An Stelle der Kritik am bestehenden Modell von Stadtentwicklung rücken so Fragen nach öffentlich mehrheitsfähigen Lösungen für aktuelle Probleme städtischer Entwicklung in den Vordergrund.
The present study examines the activities of citizens’ initiatives and the resulting interplay of politically effective actions between civil society and political decision-makers in the specific context of urban conflicts in Buenos Aires. This takes place against the backdrop of an academic debate which sees the influence of civil society marginalized and exploited to the benefit of economic and political elites, stresses the continuous peril of cooptation by dominant neoliberal ideas and promises the end of effective democratic participation. This debate serves as the motive to pursue the investigation in order to elicit the possibilities of citizens to affect urban development in the specific context of the argentine capital. First, the specific reasons are examined which help to explain the conflictive nature of neoliberal urban development and the limited influence of civil society in neoliberal urban governance. Subsequently a theoretical framework is developed, taking into account social movement research, new institutionalism and political geography in order to identify and analyze causal mechanisms of political change and corresponding factors. In two case studies - the conflicts about the construction of high-rises in the neighbourhood of Caballito and the touristification of the neighbourhood of San Telmo - the causal mechanisms and conflictive negotiation processes regarding urban development in Buenos Aires are reconstructed and analyzed, using qualitative methods of social empirical research (guided interviews, media analysis and participatory observation). The case studies demonstrate that the examined conflicts are caused by hidden, place-bound identities that get activated as a consequence of the threats posed by neoliberal urban development. In their course the conflicts are shaped by a multitude of interactions and reciprocal effects between citizens’ initiatives and political decision-makers that result at first in a struggle for interpretative dominance of public discourse and afterwards in mutual negotiation processes. The abilities to place issues on the political agenda via innovative strategies, to use the thus granted negotiation power to generate access to political decision-makers and to consider their logics of action in the resulting negotiation processes decide whether political action can be successful. At the same time, the case studies demonstrate the importance of several factors, such as the importance of formal and codified institutions as institutional „rules of the game”, supporters in the media or in political institutions as well as the connectivity of the frames used, but especially underlining the importance of the spatial extension of the causes of the conflict at hand. Regarding theory, the empirical results show that change in urban politics is not a one-sided process taking the form of continuous neoliberalization of urban development. The willingness to engage in the logics of political action in the context of existing political institutions is capable of causing transformations which prove the influence of protest activity in spite of its assumed ineffectiveness. In place of the critique regarding the existing model of urban development this puts forward questions regarding solutions to the present problems of urban development which are capable of generating major public support.
Vorschau
Rechte
Nutzung und Vervielfältigung:
Keine Lizenz. Es gelten die Bestimmungen des deutschen Urheberrechts (UrhG).
Bitte beachten Sie, dass einzelne Bestandteile der Publikation anderweitigen Lizenz- bzw. urheberrechtlichen Bedingungen unterliegen können.